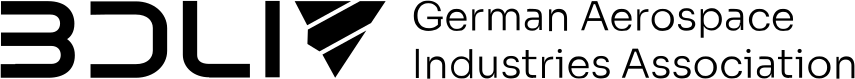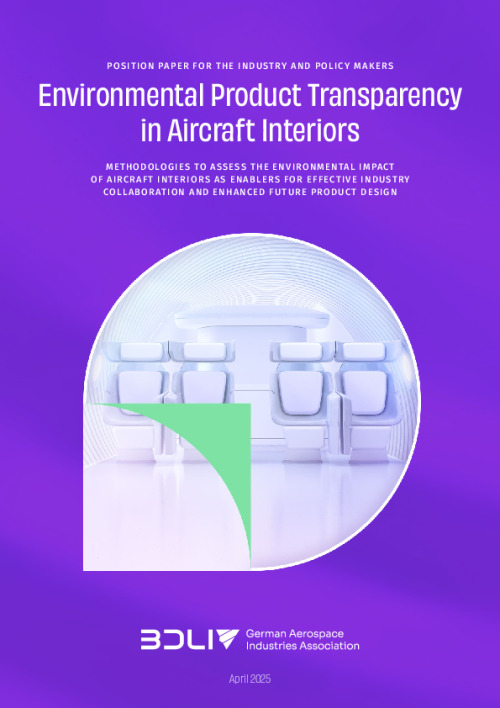Environmental Product Transparency in Aircraft Interiors
Kurz-Überblick
Ein Verkehrsflugzeug bleibt in der Regel 20 bis 30 Jahre im Einsatz. (Den Rekord bei kommerzieller Nutzung hält eine venezuelanische Airline, die ein Flugzeug seit 50 Jahren betreibt.) Das Interieur – also Sitzreihen, Teppiche, Beleuchtung und andere Armaturen – wird aber im Durchschnitt alle sechs bis acht Jahre erneuert.
Die Kabine ist daher ein Spielfeld für neueste Innovationen – und wird zugleich häufiger ausgemustert als das Flugzeug selbst.
Nachhaltigkeit ist dabei kein Nice-to-have, sondern ein zentrales Ziel der Luftfahrtindustrie. Langlebige und recycelbare Materialien schonen Ressourcen und senken Betriebskosten. Gleichzeitig reduzieren moderne Leichtbau-Sitzstrukturen das Gewicht der Kabine deutlich und senken so den Treibstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen. Ein Economy-Class-Sitz bringt heute oft nur noch acht Kilogramm auf die Waage – ein Bruchteil im Vergleich zu Autositzen, die bis zu 30 Kilogramm wiegen können.
Neue Materialien: Nachhaltigkeit und Funktionalität im Gleichklang
Doch die Branche forscht weiter, gibt sich nicht zufrieden. Beim Crystal Cabin Award 2024 war unter den Finalisten ein Sitzkonzept aus Kork, Holz und recycelten Fischernetzen – zu 100 % biologisch abbaubar. Wegen der hohen Ansprüche an Sicherheit und Leistungsfähigkeit in der Luftfahrt bleibt die Umsetzung solcher Konzepte eine Herausforderung. Neben Komfort und Design müssen die Materialien Sicherheitsstandards und Brandschutzvorschriften erfüllen sowie Druck- und Temperaturschwankungen aushalten. Der großflächige Einsatz solcher Materialien ist deshalb noch Zukunftsmusik.
Einheitliche Standards für mehr Wirtschaftlichkeit
Ein weiterer Ansatz für nachhaltigere Kabinen ist das Recycling von bestehenden Komponenten. Das Hindernis: Wirtschaftlichkeit. Die strengen Sicherheitsanforderungen, die geringe Stückzahl aufgrund individueller Airline-Designs und neuartige Werkstoffe machen das Recycling von Kabinenkomponenten sehr teuer. Wirtschaftlich lohnt es sich daher für Airlines und kommerzielle Recycling-Unternehmen nicht, die Stoffe wieder ins Flugzeug zurückzuführen.
Wissen ist Nachhaltigkeit!
Besserem Recycling oder Forschung an der richtigen Stelle stehen oft Wissenslücken entgegen. Neue Technologien könnten hier helfen, indem sie den Lebenszyklus von Komponenten digital und transparent dokumentieren und eine sichere Datenweitergabe ermöglichen. So kann jeder Baustein während seiner Fertigung von einem „Digitalen Zwilling“ – also einer digitalen Gebrauchsanweisung – begleitet werden, in der klar wird, welche Materialien verwendet werden und wie viel CO₂ in den Bauschritten ausgestoßen wird.
Ein wichtiger Schritt ist hier auch das ursprünglich durch den BDLI initiierte Aerospace X-Projekt. Dieses Projekt soll es Unternehmen ermöglichen, Daten entlang der gesamten Lieferkette souverän und gemeinsam zu nutzen.
Gleichzeitig können einheitliche Vorgaben zur Herstellung für die ganze Industrie helfen, Bauteile wiederverwendbar zu machen. Hier gibt es bereits bestehende Normen – es braucht aber weiter gedachte Regelwerke.
Schwergewichte zuerst angehen
Sitze machen etwa 43 % des Gewichts des Kabineninterieurs aus. Deshalb lohnt es sich, genau hier anzusetzen und das größte Potenzial zur Gewichtsreduktion auszuschöpfen. Aber langfristig müssen auch andere Produktgruppen einbezogen werden, um den CO₂-Fußabdruck der Kabine umfassend zu reduzieren.
Fazit: Nachhaltigkeit braucht Zusammenarbeit und Transparenz
Das Potenzial ist enorm: Leichtere Sitze, recycelbare Materialien und digitale Tools, die den Lebenszyklus jeder Komponente transparent machen, können den CO₂-Ausstoß der Kabine erheblich senken. Doch echte Nachhaltigkeit erfordert Zusammenarbeit. Hersteller, Zulieferer und Airlines müssen an einem Strang ziehen, um Standards zu vereinheitlichen und Wissen zu teilen. Nur so können wir eine Luftfahrt gestalten, die innovativ, wirtschaftlich und vor allem nachhaltig ist.
Die Arbeitsgruppe Cabin und Cargo des BDLI hat sich mit den Methoden zur Bewertung der Umweltauswirkungen von Flugzeuginnenausstattungen beschäftigt und strategische Empfehlungen für die standardisierte Umweltbewertung in der Luftfahrt formuliert. Das Ergebnis wurde jetzt veröffentlicht und befindet sich in diesem White Paper.